Tacitus und die faulen Germanen
Jene Deutschen, die sich für besonders „deutsch” halten, halten sich auch gerne für besonders fleißig. Daher ist einer der härtesten Vorwürfe, den nationalistisch gesonnene (pardon, unverkrampft patriotische) Deutsche Nichtdeutschen machen können, derjenige faul zu sein. Faul und damit auch „selber Schuld” an nahezu jeder Misere.

Klischee-Germanen des ausgehenden 19.Jahrhunderts beim Saufen und Fressen – Seifenpulver-Sammelkarte
National gesonnene Deutsche halten sich außerdem gern für „echte Germanen”, ungeachtet der Tatsachen, dass zwischen „Germanen” und „Deutschen” Jahrhunderte lagen, und dass auch Niederländer, Dänen, Schweden, Norwegen, Engländer usw. usw. usw. „germanische Völker” sind, deren Angehörige aber mehrheitlich deutlich angesäuert darauf reagieren würden, als „beinahe deutsch” vereinnahmt zu werden.
Wer einerseits stolz darauf ist, als „richtiger Deutscher” zu einem enorm tüchtigen und fleißigen Volk zu gehören, und zugleich stolz darauf, echter Nachkomme der von Cornelius Tacitus einst als blond, groß, blauäugig, sittenstreng und kämpferisch charakterisierten „alten Germanen” zu sein, hat ein Problem: Eben dieser Tacitus hielt die Germanen nämlich für ausgesprochen arbeitsscheu.
„[…]Nec arare terram aut exspectare annum tam facile persuaseris quam vocare hostem et vulnera mereri. Pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis sanguine parare.
Quotiens bella non ineunt, non multum venatibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia; ipsi hebent, mira diversitate naturae, cum idem homines sic ament inertiam et oderint quietem.[…]
[…]Man wird ihn (den Germanen) nicht so einfach dazu bringen, den Acker zu pflügen und die Ernte abzuwarten, als den Feind zu rufen und Wunden zu erhalten. Es gilt als faul und geradezu träge, sich im Schweiß zu erwerben, was man auch durch das Blut erhalten kann.
Sooft sie nicht im Krieg sind, verbringen sie mehr Zeit mit der Muße als mit der Jagd, sie sind mehr dem Schlaf und dem Essen ergeben: keiner der starken und kriegerischen Männer arbeitet etwas, sie haben die Besorgungen für Haus, Hof und Acker auf die Frauen, Alten und Schwachen übertragen: jene sind träge, durch einen auffallenden Widerspruch ihrer Natur, da sie die Trägheit ebenso sehr lieben, wie sie die Ruhe hassen. […]“
Publius Cornelius Tacitus, „De origine et situ Germanorum” („Über Herkunft und Wohnsitz der Germanen”) – kurz:„Germania”
Nicht alle „vaterländisch gesonnenen” Deutschen störten sich am auf Tacitus zurückgehenden Klischee der nicht unbedingt arbeitssamen, dafür aber umso trinkfreudigeren Germanen. In einem aus dem 19. Jahrhundert stammenden korporationsstudentischen Sauflied, heißt es zum Beispiel:
Es saßen die alten Germanen zu beiden Ufern des Rheins./
Sie lagen auf Bärenhäuten und tranken immer noch eins.
Das ist natürlich, rein historisch gesehen, haarsträubender Blödsinn, aber ein Blödsinn, der zumindest vermuten lässt, dass diese Studenten lieber fröhlich albernd Bier tranken als („typisch deutsch”) alles Bierernst zu nehmen. Anderer haarsträubender Blödsinn, den vor allem ehemalige Burschenschaftler und Corpsstudenten im durchaus nüchternen Zustand verzapften, ist weit weniger spaßig.
„Typisch germanisch” wäre also blond, blauäugig, groß, stark, sittenstreng, tugendhaft, räuberisch, arbeitsscheu und versoffen.
(Eine gewisse innerliche Widersprüchlichkeit ist diesem Bild nicht abzusprechen.)
Tacitus schrieb sozusagen im twitterfreundlichen Stil, im Vor-Internetzeitalter hätte man gesagt, er schriebe so, als ob er Telegraphengebühren bezahlen müsse. Altrömische Autoren neigten ohnehin zu einem knappen, lapidaren Stil, denn Schreibmaterial war sehr teuer, und es war, auch wenn man Schreibsklaven hatte, aufwendig, Texte durch Abschreiben zu kopieren. Einige Eigenarten der lateinischen Grammatik erleichterte es ihnen, sich kurz zu fassen, etwa der Ablativ. Beliebtes Beispiel: „Ponte facto Caesar transit” – zu deutsch: „Es wurde eine Brücke gebaut, auf der Caesar (den Rhein) überquerte”.
Der Nachtteil des knappen Stils ist, dass die Begrifflichkeiten öfter mal etwas unscharf werden. So wird nur aus dem Kontext deutlich, dass es der Rhein war, den Caesar da überquerte. Fehlt der Kontext oder ist er unklar, sind Fehlübersetzungen und Fehlinterpretationen unvermeidlich.
Tacitus war unter den kurz und knapp schreibenden Lateinern ein unbestreitbarer Meister der Kürze. Sein im Jahre 98 unserer Zeitrechnung verfasstes Germanenbüchlein umfasst im lateinischen Original in der mir vorliegende Ausgabe 22 Druckseiten (für eine Wortzählung bin ich zu germanisch bzw. faul). Es ist also kein Wunder, dass nicht immer klar ist, was C. T. eigentlich meinte. Seriöse Forscher haben ihre liebe Mühe, aus den kargen, mitunter kryptisch anmutenden Informationsbrocken des Tacitus ein schlüssiges Bild der römerzeitlichen Völkerscharen rechts des Rheins zu gewinnen. Völkische Ideologen und andere Germanentümler sparten sich diese Mühe und füllten die kargen Aussagen mit viel weltanschaulichem Schrott auf. Das Ergebnis waren tugendhafte, starke, schier unbesiegbare und selbstverständlich rassereine Super-Vorfahren. Ärgerliche Kleinigkeiten wie die von Tacitus erwähnte Trunk- und Spielsucht und eben die Arbeitsscheu müssen dabei allerdings unterschlagen werden.
Tacitus schrieb zum Aussehen der Germanen:
„(..) truci et caeruli oculi, rutilae comae, magna corpora (…)”
Das kann man mit
„trotzige blaue Augen, rotblondes Haar und hoher Wuchs”
übersetzen. Muss man aber nicht. Klebt man eng am Wörterbuch, wie ich es, aufgrund meiner eher miesen und zudem eingerosteten Lateinkenntnisse notgedrungen mache, kommt man auf
„grausame und blaue Augen, rote Haare, große Körper”
, was gleich viel weniger nett klingt.
Es handelt es sich bei dieser Beschreibung um einen sogenannten Wandertopos, oder, anders gesagt, ein allgemein verbreitetes Barbarenklischee, welches auf das klassische Griechenland zurück ging. Auch die Thraker, die Skythen und die Kelten wurden von griechischen Autoren wie Herodot als blauäugig und rothaarig beschrieben. Rothaarige galten schon im klassischen Griechenland als jähzornig, außerdem als unberechenbar und verschlagen – der „listenreiche Odysseus” wurde deshalb gern als „Rotschopf” dargestellt. Blondes Haar, bei den Griechen eher selten, galt dagegen als besonders attraktiv, geradezu als göttlich – die „schöne Helena” und der „lichte Apollon” waren daher auf vielen Bildwerken und bemalten Statuen hellblond. Also hatte ein anständiger Barbar kein „goldenes”, sondern „feuerhaftes” Haar zu haben!
Tacitus war nie in Germanien gewesen und seine Quellen kennen wir nicht. Wandertopoi, die vielen „Barbarenvölkern” zugeschrieben wurden, gibt es in der Germania so einige, nebst spezifischeren Klischees, die wahrscheinlich aus den Berichten römischer Militärs und deren Blickwinkel – präzise beobachtet, was die potenzielle Kampfkraft angeht, hingegen anekdotisch, mit Vorliebe für „exotische” Details, die ruhig einmal nicht so ganz wahrheitsgemäß sein dürfen, wenn es um den Alltag geht – herrühren.
Es schien Tacitus im wesentlichen darum gegangen zu sein, seinen römischen Zeitgenossen einen Spiegel vorzuhalten: Naive, aber unverdorbene Wilde als mahnender Kontrast zum dekadenten, von politischen Intrigen zerfressenen, von ehrgeizigen Herrschern gegängelten Rom, wie er es z. B. in seinen berühmten „Annales” schilderte.
Aber für Tacitus waren die Germanen nicht nur moralisch vorbildhaft, sondern vor allem militärisch gefährlich. Schon 210 Jahre siege man an Germanien herum, mokierte er sich. In der Tat, nördlich der Donau und östlich des Rheins errang das Imperium immer nur Teilerfolge nebst einiger herber Rückschläge. Tacitus, der ein ausgesprochen stadtrömisches Weltbild hatte und nostalgisch den Tugenden aus republikanischer Zeit hinterhertrauerte, meinte, dass, wenn die Germanen schon nicht die Römer lieben lernen könnten, sie bitte untereinander entzweit bleiben sollten, da ja nichts so hilfreich für Rom sein könne wie die Uneinigkeit seiner Feinde. Herbe Kritik an der oft selbstherrlichen Machtpolitik des kaiserzeitlichen Roms!
Jedenfalls ist die „Lehnstuhlethnografie”, wie der Altphilologe Christopher B. Krebs die „Germania” nennt, alles andere als eine objektive und neutrale Quelle.
„Unvermischt mit anderen Völkern” waren die Germanen bekanntlich nicht, das war ein weiteres Barbarenklischee, dem Tacitus aufsaß. Wie er auf die Idee kam, dass ihre Körperbeschaffenheit „trotz der großen Menschenzahl bei allen die Gleiche” sei, ist nicht ganz klar, denn er hatte ja in Rom einige richtige, lebendige Germanen mit eigenen Augen gesehen. Ich vermute, dass es ihm dabei mehr um die knackige Aussage als die Wahrheit ging und male mir an dieser Stelle aus, wie Tacitus auf dem Forum seine arglosen Mitrömer mahnte: „Ihr wisst doch, wie die germanischen Leibgardisten des Kaisers aussehen, ja? Die Germanen sind alle so gebaut! Stellt euch mal ein ganzes, riesiges Land voller solcher baumlangen Muskelprotze vor.”
In der Tat waren viele Bewohner Germaniens tatsächlich blond. Moorleichenfunde bestätigen weitgehend eine vorherrschende helle Haarfarbe, wobei rot und rotblond nicht auffällig häufig war.
Skelettfunde zeigen, dass die Germanen tatsächlich im Schnitt größer waren als die Römer. Allerdings waren sie keine „Riesenkerle”: Untersuchungen von Skeletten zeigen, dass der germanische Mann der Völkerwanderungszeit und des Frühmittelalters zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß war (Frauen waren um rund 10 cm kleiner). Skelette aus dieser Epoche mit reichen Grabbeigaben waren im Schnitt um einige Zentimeter größer als der große, vergleichsweise ärmlich bestattete Rest (das zeigen unter anderem die Untersuchungen der alamannischen Gräber von Weingarten und Bohlingen). Wie in späterer Zeiten hing die Körpergröße außer von genetischen Faktoren von der Qualität der Ernährung ab. Die Unterschiede zwischen arm und reich beweisen, dass die Germanen der Völkerwanderungszeit sozial gesehen nicht „alle gleich” waren.
Daran, dass die Germanen bzw. die Völker und Stämme, die Tacitus so bezeichnete, tatsächlich kriegerisch waren, besteht wenig Zweifel. Die kulturell ähnlichen Stämme, die die Römer als Germanen zusammenfassten, waren zersplittert, dauernd gab es Streit, der oft mit bewaffneten Mitteln ausgetragen wurde, in Form von Kleinkriegen und dem, was man im Mittelalter „Fehden” nannte – was für Stammesgesellschaften nicht untypisch ist. Jedenfalls war das Kriegerideal hoch geschätzt, auch in Friedenszeiten, und dazu gehörte es selbstverständlich, permanent kampfbereit zu sein.
Aber waren die „alten Germanen” wirklich faul? Die meisten Germanen – von den wenigen spezialisierten Handwerkern, Händlern und fahrenden Sängern, die man als Vorgänger der Skalden ansehen kann, abgesehen – betrieben Landwirtschaft. Das galt auch für die Oberschicht – ein „richtiger” Adel sollte sich erst im Mittelalter herausbilden – die allerdings Halbfreie, also abhängige Bauern, und Sklaven auf ihren Höfen arbeiten ließen. Was im Prinzip bei der landbesitzenden römischen Oberschicht nicht anders war. Berufssoldaten, die nur kämpften, aber nicht ackerten, gab es innerhalb der Stammesgesellschaft nicht, hingegen dienten viele Germanen in den Hilfstruppen der römischen Armee, später auch in der regulären Legion. Auch wenn unter patriarchalischen Verhältnisse die meiste Arbeit an den Frauen hängen bleibt, kann man nicht sagen, dass nur die Frauen arbeiteten, von den „Altern und Schwachen” gar nicht zu reden.
Fast alle Menschen in der „Germania magna” arbeiteten also in der Landwirtschaft. Nun weiß jeder, dass Landarbeit unter vorindustriellen Bedingungen harte Arbeit ist, vor allem zur Erntezeit, und das der bäuerliche Arbeitstag lang war und früh begann. Außer einigen reichen Großbauern / „Adligen” könnte es demnach eigentlich keine Faulenzer gegeben haben.
Das stimmt nicht ganz. Die Germanen waren nicht nur kriegerisch, sie waren im großen und ganzen, im Vergleich zu den Römern, aber auch den Kelten, rückständig und arm – wobei es starke regionale Unterschiede gab. Ihre „Produktivkräfte” waren im Allgemeinen wenig entwickelt. Es gibt mehrere Gründe, wieso das so war, einer war sicherlich die aus der modernen „Entwicklungspolitik” wohl bekannte „Armutsfalle” – um die Produktivkräfte zu entwickeln, etwa durch bessere Verkehrswege und bessere Geräte, braucht man Kapital, und um Kapital – nicht unbedingt in Form von Geld – anzusammeln, braucht man aber erst einmal eine Produktion, die Überschüsse abwirft. Übrigens waren die Raubzüge, für die die Germanen (wie später auch die Wikinger) berüchtigt waren, auch ein Versuch der „Kapitalbeschaffung”. Im Falle der Wikinger sehr erfolgreich. Reichtum erleichtert den Übergang vom „Räuber” zum „ehrbaren Kaufmann” enorm, und nach ein paar Jahren fragt keiner mehr nach der Herkunft des Startkapitals.
Etwas verallgemeinert fehlte es rechts vom Rhein und nördlich der Donau so ziemlich an allem, was ein Römer unter „Zivilisation” verstand. Es gab keine Städte, keine befestigten Straßen und keine zentrale Verwaltung, nur Stämme, die sich selten einig waren, kurz gesagt, keinen Staat. Ein Nachteil: Missernten führten, wenn die eigenen Vorräte aufgebraucht waren, zu Hungersnöten, weil es kaum Möglichkeiten gab, Nahrungsmittel aus Gegenden mit besserer Ernte einzuführen.
Der Vorteil, vor allem für die „Freien”, die keine „Großbauern” / „Stammesfürsten” waren: Es gab auch keine Steuern und Abgaben! Den sächsischen Bauern, die einige Jahrhunderte später unter die Herrschaft fränkischer Könige kamen, kamen Steuern zuerst wie räuberische Erpressung vor – und erst recht empört waren sie über den an die Kirchen abzuliefernden „Zehnten”. Diese materiellen Nachteile der freien Bauern waren wesentliche Gründe dafür, wieso die Sachsenkriege Karls des „Großen” so lang und blutig waren.
In der Zeit vorher konnte ein freier Bauer das, was er über den Eigenbedarf seiner Sippe / Großfamilie hinaus erwirtschaftete, verkaufen oder eintauschen. Nur gab es wenig, was er hätte kaufen und tauschen können. Es gab, in einer Gesellschaft, in der praktisch jeder Landwirtschaft betrieb und in der keine Städte und kein Berufsheer versorgt werden mussten, nur wenige Abnehmer für überschüssige Lebensmittel. Also bestand auch wenig Anlass, die Erträge zu steigern.
Weil unser germanischer Bauer nur so viel Land bestellte, dass er genug für den Eigenbedarf nebst Notvorräten und dem einen oder anderen Erzeugnis, dass er verkaufen oder eintauschen konnte, ernten konnte, war er natürlich außer zur Erntezeit bereits nach wenigen Stunden mit seiner Arbeit durch – nicht deshalb, weil er den Müßiggang bevorzugt hätte, sondern weil er schlichtweg keine produktive Tätigkeit mehr finden konnte. Im Schnitt arbeitete ein mittelalterlicher Bauer aufs Jahr gerechnet weniger Arbeitsstunden als ein Vollzeit arbeitender Arbeitnehmer unserer Zeit. Sein von Steuern, Zehnten und gegebenenfalls Pachtzinsen freier Vorfahre im Altertum wird eher noch weniger Zeit mit Ackern verbracht haben, trotz geringerer Erträge je Hektar.
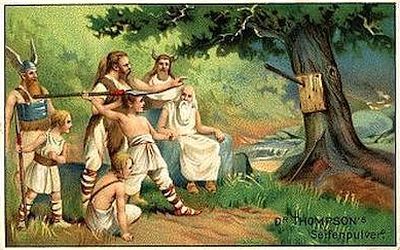
Klischee-Germanenknaben des ausgehenden 19.Jahrhunderts bei der Waffenausbildung – Seifenpulver-Sammelkarte
Wenn also ein römischer Reisender einen germanischen Hof besuchte, sah er dort wahrscheinlich, außer zur Erntezeit im Spätsommer, dass gerade die kräftigen Männer viel Zeit mit Faulenzen und Kampfübungen verbrachten – nur die, an denen die Hausarbeit hängen bliebt, also Frauen, noch nicht wehrfähige Minderjährige und nicht mehr wehrfähige Alte, sah er eventuell arbeiten. Wenn der Römer, was anzunehmen ist, vor allem vornehme Großbauern und Kleinfürsten besuchte, ertappte er, weil die meisten Arbeiten von Halbfreien und Sklaven erledigte wurde, dort praktisch nie einen freien germanischen Bauern bei der Arbeit.
Das ist etwas vereinfacht, weil es gerade auf den größeren Höfen auch außerhalb der Landwirtschaft produktive Arbeiten gab, z. B. Handwerk. Hätte die „alten Germanen” tatsächlich den ganzen Tag im Schweiße ihres Angesichts ackern müssen, hätte ihr Handwerk nicht das Niveau erreicht, das es hatte. Die Probe aufs Exempel ist die materiell ärmliche Jastorf-Kultur im heutigen Niedersachsen: Wegen der karge Böden und einem zu dieser Zeit ungünstigen Klima war viel Aufwand nötig, um sich zu ernähren. Weniger freie Zeit und keine Überschüsse, die z. B. gegen Rohmaterial und Werkzeuge getauscht werden könnten zogen eine ärmliche Sachkultur nach sich – trotz kultureller Verwandtschaft dieser Frühgermanen mit der frühkeltischen Hallstattkultur und später der keltischen Latènekultur.
Den Kelten, als unmittelbare Nachbarn der Germanen, war es vor allem durch ihr hervorragendes Schmiedehandwerk gelungen, aus der „Armutsfalle” zu entkommen – sie hatten etwas Wertvolles zu exportieren. Zur Römerzeit stand diese Option Völkern außerhalb des Imperiums nicht mehr offen, denn die Konkurrenz der römischen „Metallindustrie” – die zum großen Teil ursprünglich keltisch war – wäre dafür zu hart gewesen.
Schon in der Antike wurde Armen vorgehalten, sie seinen wegen ihrer Arbeitsscheu arm. Dieses Schema wurde auch auf ganze Völker angewendet – waren sie arm, lag es nach römischer Ansicht daran, dass diese Barbaren eben faul und vergnügt in den Tag gelebt hätten, anstatt sich ordentlich anzustrengen!
Allerdings wäre niemand, auch Tacitus nicht, auf die Idee gekommen, dass die Germanen, wenn sie nur fleißiger wären, bald genau so wohlhabend wie die Römer sein würden. Er erwähnt die widrige Umständen, wie etwa das raue Klima, und auch, dass ein Germanenstamm, der zu Wohlstand gekommen wäre, mit räuberischen und kriegerischen Übergriffen anderer, germanischer und nichtgermanischer, Völkerschaften rechnen musste.
Da Fleiß nach antikem Verständnis stets Mittel zum Zweck war, nicht, wie im Christentum, eine Tugend an sich, und da körperliche Arbeit sowieso etwas war, was ein zivilisierter Mensch möglichst den Sklaven überließ, trübte der Vorwurf der Faulheit das idealisierte und den „dekadenten Römern” als Beispiel traditioneller Tugenden vorgehaltene Germanenbild des Tacitus jedoch wenig.
Martin Marheinecke
Hallo!
Super Artikel!
Ich selbst unterlag auch immer den Germanenklischees, bis ich mich näher mit dieser Thematik beschäftigte.
Interessant ist, dass du geschrieben hast, dass der Großteil der Germanen anscheinend wirklich blond war.
Nun müsste meiner Meinung abgeklärt werden was blond bedeutet.
Bedeutet blond das „Barbiepuppen-Blond“ an das in Wirklichkeit viele denken oder versteht man darunter alle Farbschattierungen. Dunkelblond wirkt oftmals sehr braun.
Trotzdem sehr guter Artikel!
Schönen Tag noch!
Danke Raedwulf!
Wie blond waren „die Germanen“? Im statistischen Mittel hatten die Mitteleuropäer damals hellere Haare, als Menschen aus dem Mittelmeerraum – wie ja selbst heute noch. Die Haarfarbe der Moorleichen ist rötlich verfärbt – was einige Gelehrte des 19. Jahrhunderts veranlasste, „ihren Tacitus“ wörtlich zu nehmen und „den Germanen“ generell rötliches Haar zuzuschreiben. Erst die Untersuchung im Labor zeigt, welche Farbe die Haare zu Lebzeiten hatten.
Grundsätzlich ist bei Moorleichen und bei anderen antiken und frühmittelalterlichen Grabfunden in Mitteleuropa, bei denen durch günstige Umstande Haare konserviert wurden, alles an Haarfarben dabei.
Gentechnische Untersuchungen an Geweberesten, die seit einiger Zeit möglich sind, bestätigen das. Ob jemand zu Lebzeiten Germane, Kelte oder Slawe war, lässt sich anhand anatomischer Merkmale, einschließlich Haarfarbe, natürlich nicht sagen. Auch Aussagen der Populationsgenetik, etwa anhand des Vorkommens einer bestimmten Haplogruppe, funktionieren nur statistisch.
Es ist tatsächlich so, dass es eine „Hochburg der Hellblonden“ im nördöstlichen Ostseeraum – östliches Mittelschweden, südwestliches Finnland, Baltikum – gab (und noch gibt), über „ethnische Grenzen“ hinweg. Auch weil die „Urheimat der Germanen“ gern in Skandinavien gesehen wird – weil z. B. die Goten behaupteten, ihre Vorfahren wären aus Schweden gekommen, was allenfalls nur für einen kleinen Teil der Goten zugetroffen haben könnte – stellt man sich „die Germanen“ oft als durchgehend „weizenblond“ vor.
Übrigens wurde Moorleichen in der Vergangenheit allzu gern „mit dem Tacitus in der Hand“ interpretiert. Ein berühmter Fall ist das „Mädchen von Windeby“, vermeindlich eine gemeinsam mit ihrem Geliebte „zum Tode verurteilte Ehebrecherin“ – nur: „sie“ war ein junger Mann, der „Geliebte“ stammte aus einer anderen Epoche, es sind keine Spuren eines gewaltsamen Todes feststellbar, „ihre“ Augen waren gar nicht verbunden, und „ihr“ (übrigens hellblondes) Haar war wohl eher aus modischen Gründen als aufgrund einer Strafe wegen teilweise kurz geschoren. Er wurde wahrscheinlich im Moor bestattet, nachdem er eines frühen, aber natürlichen Todes gestorben war.
Ein anderer Fall ist der „Grauballe-Mann“ aus einem Moor im südlichen Dänemark, der übrigens wirklich hingerichtet wurde, per Kehlschnitt. Weil er zu Lebzeiten dunkle Haare und dunkle Augen gehabt hatte, und weil seine Hände keine Spuren von schwerer körperlicher Arbeit zeigten, mutmaßten die Archäologen, er müsse wohl ein „Fremder aus dem Süden“ gewesen sein. Angesichts der ziemlich genau bestimmbaren Zeit seines Todes – um das Jahr 290 – ist gerade in Heidenkreise die Annahme weit verbreitet, er sei ein erfolgloser Missionar gewesen. Allerdings wurden schon kurz nach der Fundbergung seine Fingerabdrücke abgenommen und mit kriminaltechnischen Methoden untersucht: seine Hautlinienmuster entsprechen denen, die noch heute in der südjütischen Bevölkerung vorwiegen. Der Mann war also aller Wahrscheinlichkeit „von hier“. DNA-Untersuchungen bestätigten später den Befund, dass er aus dem südlichen Skandinavien gestammt haben dürfte. Wahrscheinlich war er Angehörige der örtlichen Oberschicht, und wahrscheinlich – da wäre Tacitus ausnahmsweise hilfreich gewesen – zu Lebzeiten ziemlich „faul“.
MartinM
Hi!
Danke für die sehr ausführliche Antwort!
Meiner Meinung nach darf man sowieso nicht von „die Germanen, Kelten oder Slawen“ als homogene Ethnie sprechen und da benötigt es eben sehr noch viel Aufklärungsarbeit.
Diese Seite dient wirklich dazu all die Mythen und Legenden zu entzaubern.
Dürfte ich vielleicht erfahren welche Quelle du benutzt?
Raedwulf
Danke!
Die Frage nach den Quellen ist nicht ganz einfach zu beantworten. Für meine Artikel (d. H. die mit „Martin Marheinecke“ oder „MartinM“ gekennzeichneten) , abgesehen von den Kurzmeldungen und meinen Beiträgen fürs „Gjallarhorn“ kann ich sagen, dass ich möglichst aktuelle Fachliteratur und seriöse Websites verwende, wobei ich nach Möglichkeit mehrere Quellen heranziehe – und ich auch der Wikipedia nicht kritiklos vertraue. Ich gehe journalistisch vor, was auch bedeutet, dass ich meistens auf einen Quellenapparat verzichte. Bei anderen Autoren / Autorinnen kann es im Einzelfall anders sein, z. B. wenn sie aus eigener Erfahrung berichten. Außerdem habe wir (die Nornirs Ætt) auch ein paar Wissenschafter/Innen unter uns, die es u. U. auch anders halten.
Für diesen Artikel legte ich, außer einer zweisprachigen Ausgaben der „Germania“, folgende Werke zugrunde: „Die Germanen“ von Walter Pohl, Oldenbourg, München 2000, „Die Germanen“ von Rudolf Simek, Reclam Verlag, Stuttgart 2006, „Götter und Kulte der Germanen“, ebenfalls von Rudolf Simek, C. H. Beck, München 2004, ferner das „Spiegel“-Interview: „“Cäsar hat die Germanen erfunden“ mit dem Althistoriker Mischa Meier und der Artikel „Land der Biertrinker – : Meisterhaft knapp beschrieb der Historiker Tacitus das Wesen der Germanen“ von Johannes Saltzwedel, beide enthalten im „Spiegel-Geschichte“ Heft „Die Germanen“ (2013), außerdem die entsprechenden Artikel in der Wikipedia. Nicht als Quelle, aber als Anregung: http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Die-Germanen/1603478.html
MartinM
Zu den Berichten der antiken Zeitzeugen möchte ich folgendes anmerken:
Die Variante, dass Tacitus dahingehend „übersetzt“ wurde, die Germanen seien blond und blauäugig , stammt vorwiegend von nationalromantischen Bearbeitungen aus dem 19. Jh. (z.B. Baumstark). Allerdings gab es auch zu jener Zeit sehr gewissenhafte Übersetzer, die recht unideologisch dieses Werk bearbeiteten. Was die Augenfarbe jedoch betrifft, so halte ich „grausam“ für eine nicht richtige Übersetzung – hier sprechen die lateinischen Texte tatsächlich eher von „widertrotzig, trotzig“ und „blauäugig“. Das wäre exakter.
Die Aussage, dass die Griechen die Kelten ebenfalls per se als rothaarig bezeichneten, kann ich so jetzt nicht bestätigen. Insbesondere Strabon und Diodor beschrieben die Kelten witzigerweise als blond – auch in den überlieferten altgriechischen Originaltexten.
Sicher sind die Beschreibungen der antiken Autoren diesbezüglich ungenau und zu hinterfragen. Auch mag man die Details als nicht so wichtig empfinden – dem ist allerdings zu entgegnen, dass die Details falsch dargestellt die größten Mythen erzeugten. Wie wir gut aus unserer Geschichte erkennen können.
Danke für den guten Artikel, mit freundlichen Grüßen, Vailos
Vielen Dank, Vailos!
Ich bin, wie ich ja im Text erwähnte, ein ziemlich lausiger Lateiner – „grausam“ war eine Variante unter mehreren, die ich Bedeutung von „truci“ fand, und zwar in meinem Wörterbuch als obersten Vorschlag. „Caeruli“ ist im Zusammenhang mit Augenfarben „blau“, so habe ich es auch übersetzt.
Ich will damit zeigen, wie fragwürdig die „nationalromantischen“, sehr positiv klingenden, Übersetzungen sind.
Strabon, Diodor und andere Geographen und Historiker des späten Hellenismus und der römischen Kaiserzeit kannten Kelten und ihre Kultur bereits aus eigener Anschauung, sodass das „Barbarenklischee“ nicht so stark durchschlug, wie bei Autoren, die sie nur aus zweiter und dritter Hand kannten. Sie beschrieben ja, neben allerlei, was ihnen exotisch und barbarisch vorkam, auch die zivilisierten Seiten der Kelten.
Wenn Strabon die Kelten als „blond“ beschrieb, dann verallgemeinerte er eine Beobachtung – es gab ja tatsächlich mehr blonde Kelten als blonde Griechen. Analog zum im Deutschland heute noch verbreiteten Klischee, dass „die Schweden“ blond seinen, weil es in Schweden tatsächlich statisch gesehen mehr blonde Menschen gibt als in Deutschland. Die „typisch keltische“ Haarmode, die sie beschrieben und die auch in der griechischen Kunst dargestellt war, mit Kalkwasser gestärkte Haare, die durch diese Behandlung auch stark aufhellten, trug sicherlich auch dazu bei, „die Kelten“ als „durchweg blond“ wahrzunehmen.
Wandertopoi und Wandermythen, wie die des „rothaarigen, riesigen, muskelstarken“ Barbaren gibt außer in mythologischen und fiktiven Texten (in Grund bis heute: Conan!), ja vor allem dort, wo nichts Genaues bekannt ist. Bei Tacitus kommt hinzu, dass er im Grunde Propaganda machte und in seinem Germanenbild wahrscheinlich absichtlich den „Klischeebarbaren“ herausstellte – in positiver („edler Wilder“) wie in negativer („brutal, faul, trunksüchtig“) Hinsicht.
MartinM
Pingback: Wann Fleiß eine Sünde und Faulheit eine Tugend ist - Asatru zum selber Denken - die Nornirs Ætt
Pingback: Nachrichten aus´em Wald: BIER | HEIMDALL WARDA – Die das Gras wachsen hören
Pingback: Klug – fleißig – faul – dumm? Christliche und heidnische Tugenden | HEIMDALL WARDA – Die das Gras wachsen hören